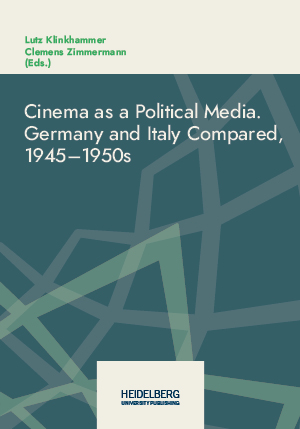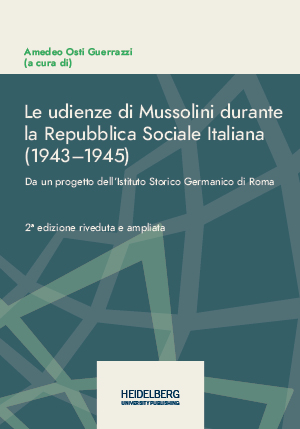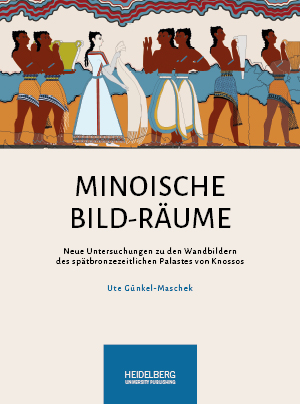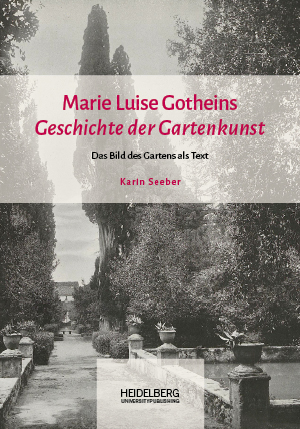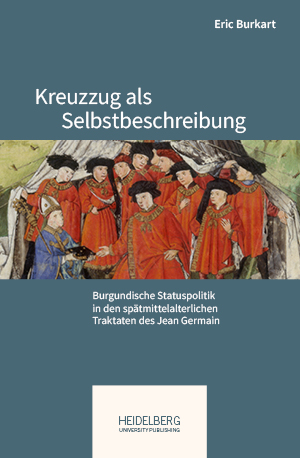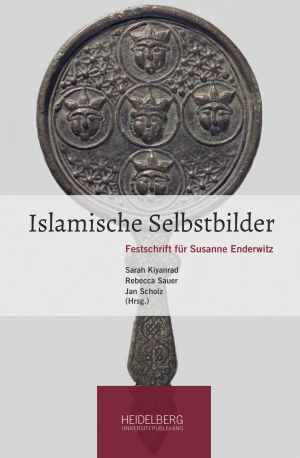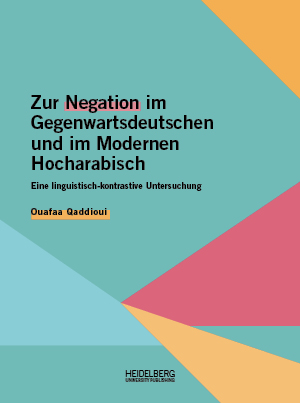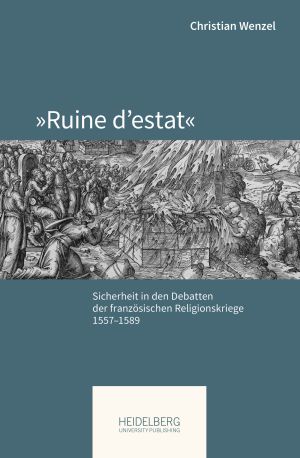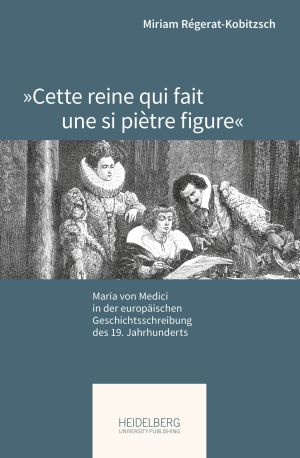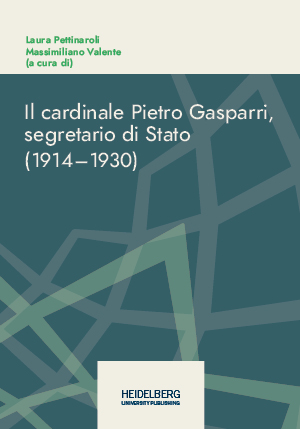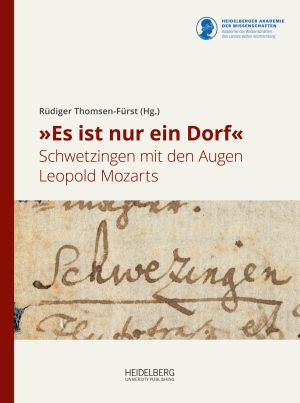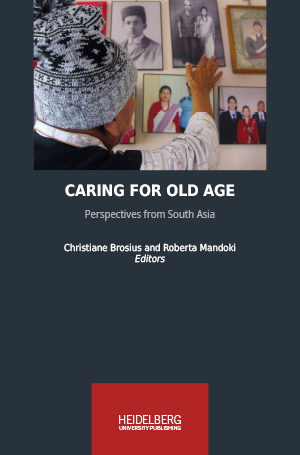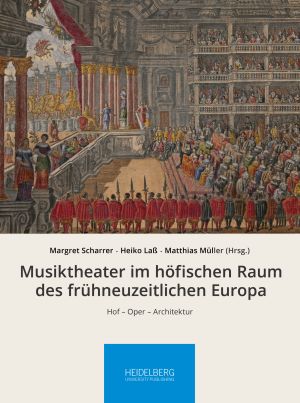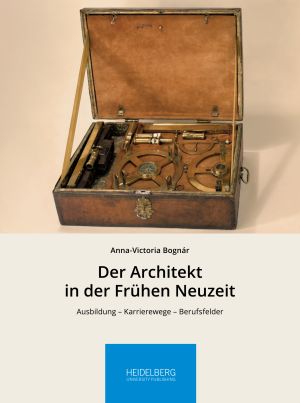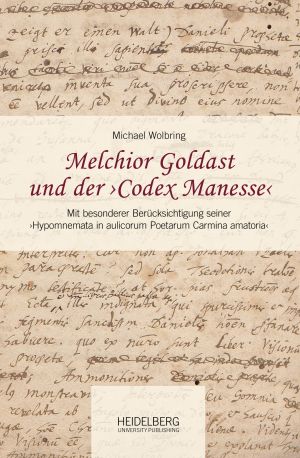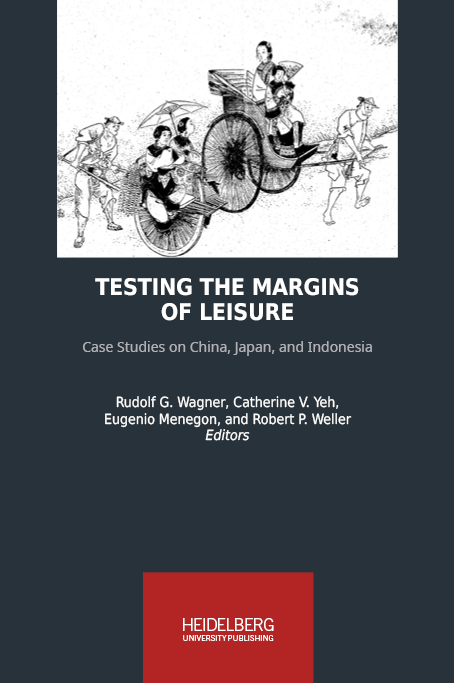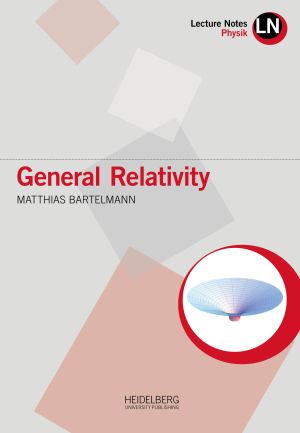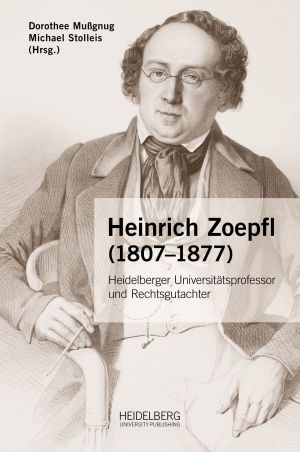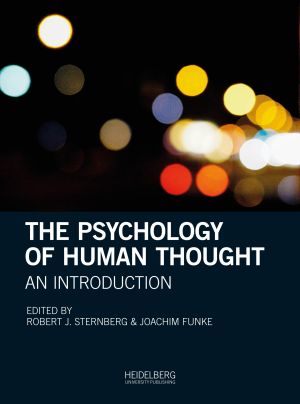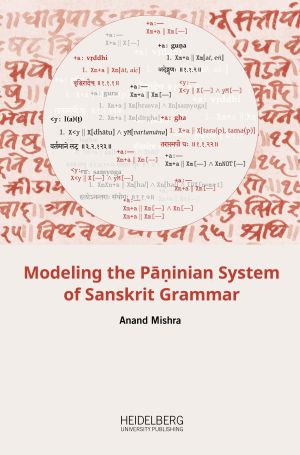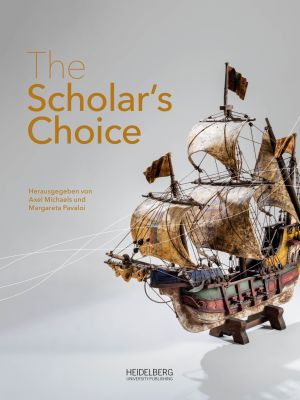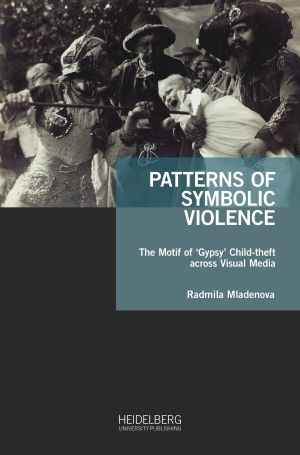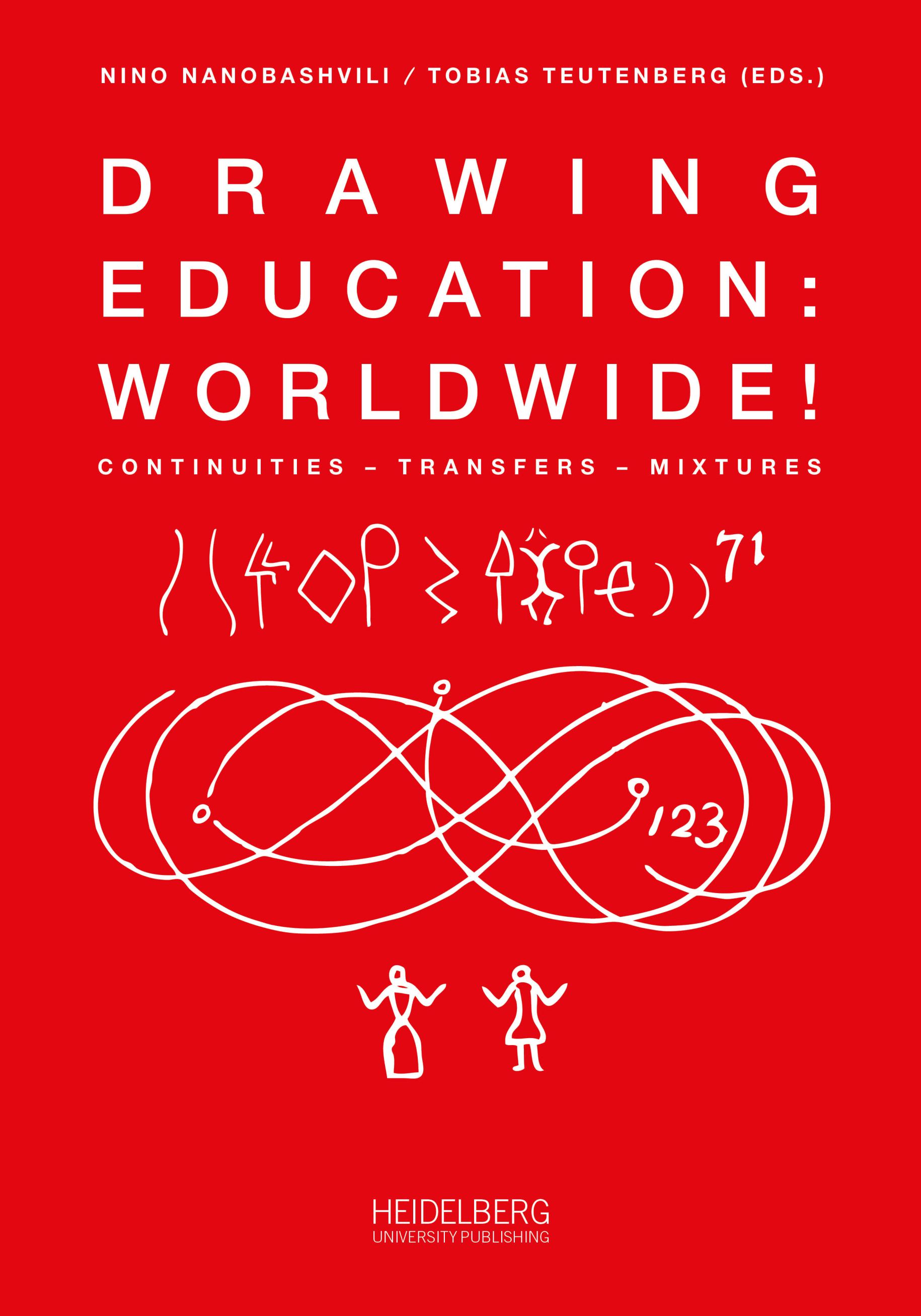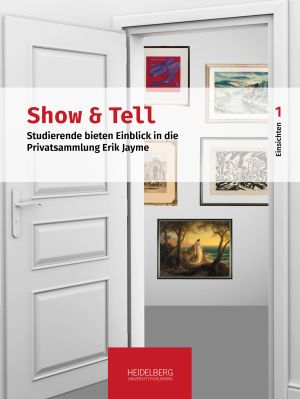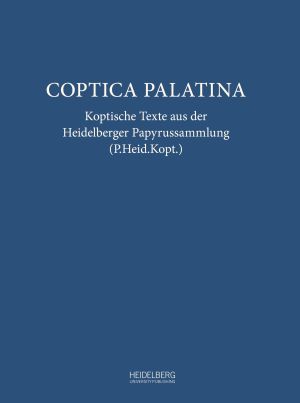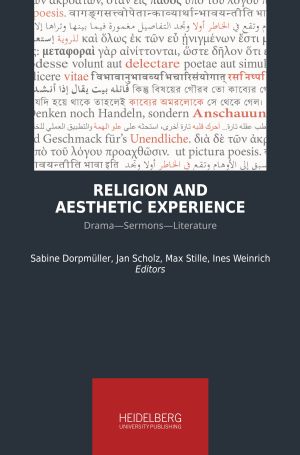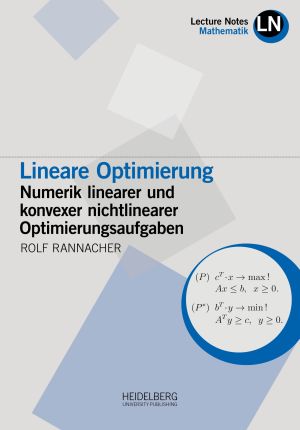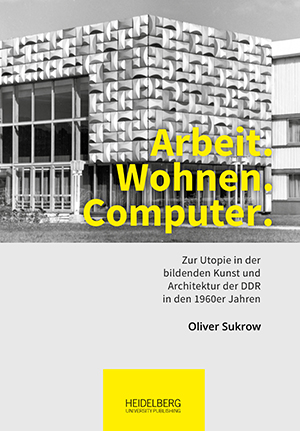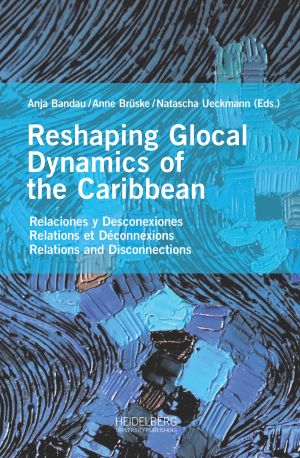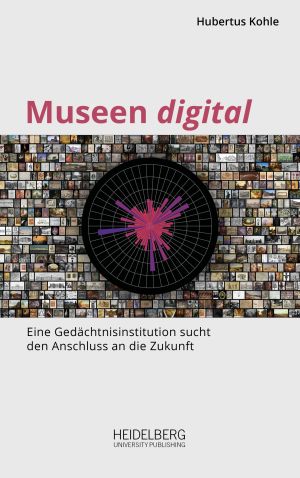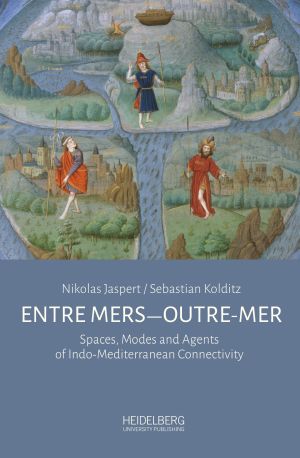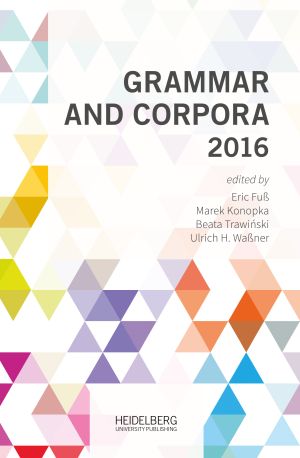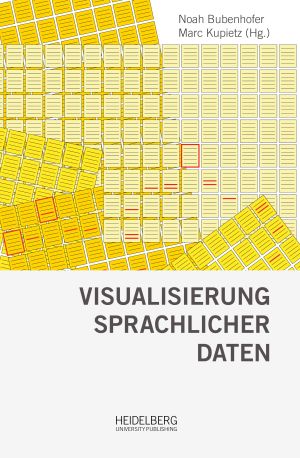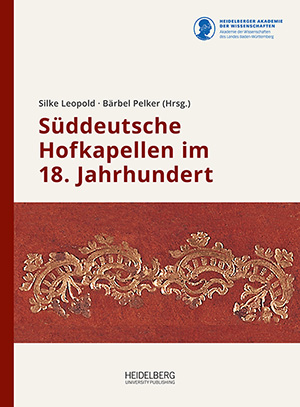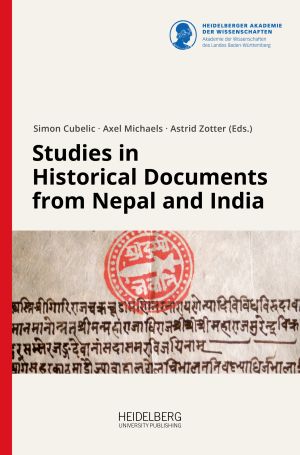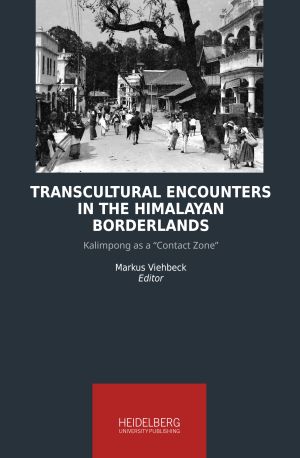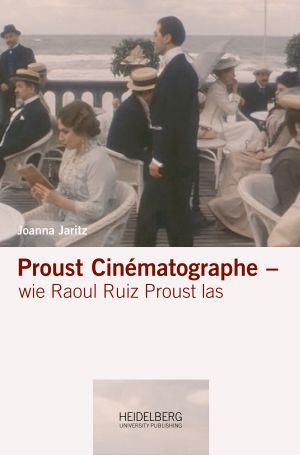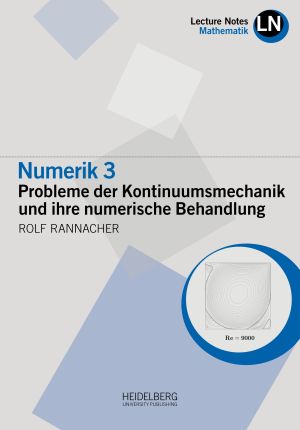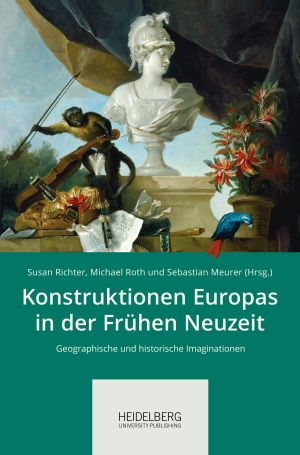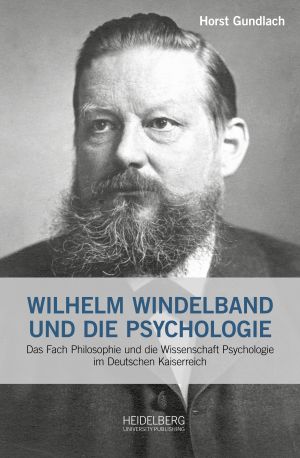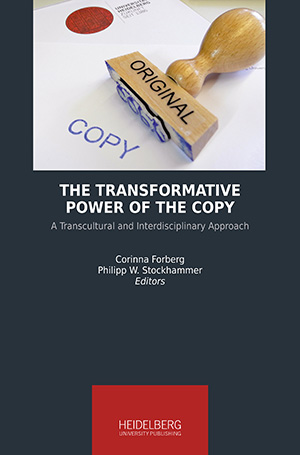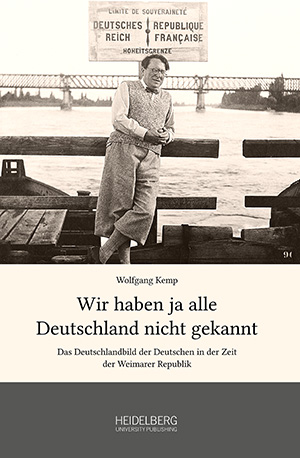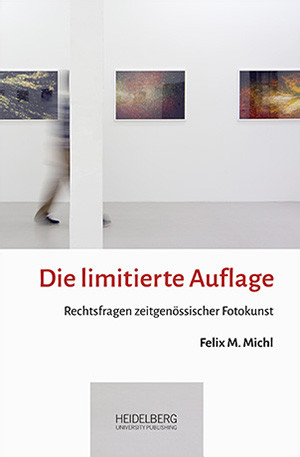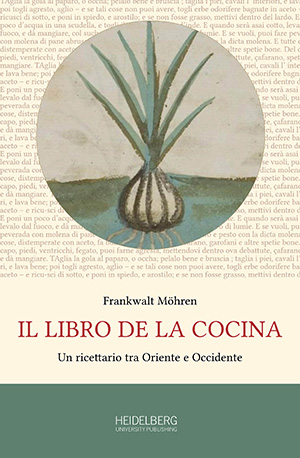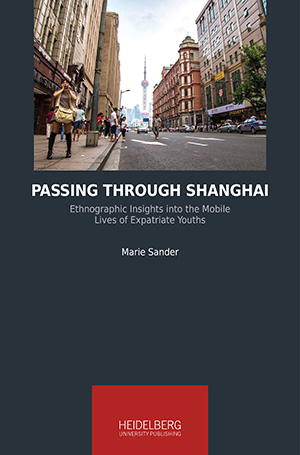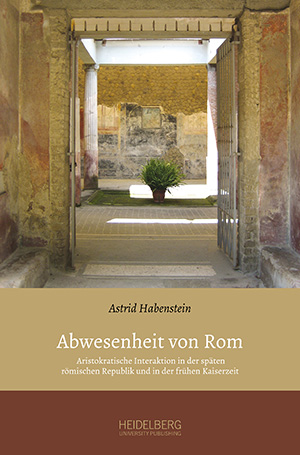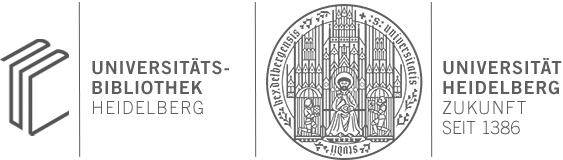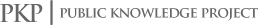Bücher
Cinema as a Political Media: Germany and Italy Compared, 1945–1950s
Aus einem vergleichenden, transnationalen Ansatz heraus nimmt die internationale Autorengruppe die jeweiligen nationalen Interpretationen der Vergangenheit in Deutschland und Italien, wie sie sich im Medium des Films zwischen 1945 und etwa 1955 darstellen, in den Blick und thematisiert auch die wechselseitige Wahrnehmung der Filme. In den 12 Beiträgen werden sowohl die filmischen Erzählmuster von wichtigen Einzelwerken analysiert als auch der zeitgenössische Kontext der Debatte über die Schrecken und Traumata der nationalsozialistischen wie faschistischen Vergangenheit in den beiden Ländern einbezogen.
Antigypsyism and Film / Antiziganismus und Film
Antiziganismus ist Normalität auf der großen Leinwand. Um dieses Problem aus unterschiedlichen Perspektiven zu untersuchen, versammelten sich Wissenschaftler und Nachwuchsforscher, Filmemacher und Menschenrechtsaktivisten – Roma wie Nicht-Roma – 2018 in Berlin zu einer internationalen Tagung: “Antiziganismus und Film“. Sie präsentierten ihre Forschungsergebnisse, teilten persönliche Zeugnisse und diskutierten Filme. Der vorliegende zweisprachige Band dokumentiert diese in ihrer Form bisher einzigartige Tagung.
Der Tagungsband umfasst wissenschaftliche Artikel und Essays sowie Interviews mit Filmemachern, unterteilt in vier thematische Abschnitte: Antiziganismus im Film, Fragen der Ethik, Strategien der Subversion und Antiziganismus im Verhältnis zu anderen Ressentiments.
Le udienze di Mussolini durante la Repubblica Sociale Italiana, 1943–1945: 2., erweiterte und überarbeitete Auflage
Im römischen zentralen Staatsarchiv befindet sich der Terminkalender mit den Audienzen, die Mussolini in der letzten Phase des Faschismus, das heißt während der Italienischen Sozialrepublik (Repubblica Sociale Italiana), gehalten hat. Der Band macht ihn nun erstmalig der wissenschaftlichen Forschung zugänglich und ergänzt die Einträge um die Inhalte der Gespräche, die – soweit möglich – unter Heranziehung der Memorialistik und von Dokumenten aus dem Privatsekretariat des Duce rekonstruiert werden.
Die von Portheim-Stiftung in Heidelberg: 100 Jahre für Wissenschaft und Kunst
Die ›Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst‹ beging im Jahr 2019 das Jubiläum ihres 100jährigen Bestehens. Zu diesem Anlass gibt das Buch einen Abriss über die Entwicklung der Stiftung, ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen und Sammlungen von der Gründung bis zum schwierigen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Es behandelt damit auch die Geschichte des heutigen Völkerkundemuseums vPST, das auf dem früheren Ethnographischen Institut der Stiftung beruht. Die Publikation gibt Einblicke in das Leben und Wirken der Stifter, Victor und Leontine Goldschmidt, die Stiftungsidee und deren Entfaltung in den 1920er-Jahren sowie die Verwerfungen unter dem NS-Regime. Es thematisiert die wissenschaftliche Arbeit des bekannten Kristallographen Victor Goldschmidt, seine Versuche eines Brückenschlags zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und die vielfältigen Beziehungen, die zwischen der Stiftung und der Universität Heidelberg bestanden.
Minoische Bild-Räume: Neue Untersuchungen zu den Wandbildern des spätbronzezeitlichen Palastes von Knossos
Der vorliegende Band stellt eine neue Analyse der Wandbilder vor, die vor über 100 Jahren an den Wänden des bedeutendsten Zentrums der minoischen Kultur, des Palastes von Knossos, gefunden wurden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht der Begriff des Bild-Raums, eine theoretisch begründete, relationale Verknüpfung von Bildelementen, Menschen, Handlungen und Orten. Das Ziel ist es, basierend auf dem Wanddekor einzelner Gebäudetrakte ein besseres Verständnis der einst mit ihnen verbundenen Rituale, Ideen und Personen zu gewinnen. In ausführlichen Fallstudien werden die Bild-Räume dreier bedeutender Palastareale analysiert, rekonstruiert und in ihren spätbronzezeitlichen Kontext gestellt.
Verwandtsein und Herrschen: Die Königinmutter Catherine de Médicis und ihre Kinder in Briefen, 1560–1589
Catherine de Médicis war fast 30 Jahre lang eine zentrale politische Figur der französischen Monarchie. Ihre Autorität beruhte auf ihrer Position als Königinmutter. Die Studie geht der Frage nach, was Verwandtsein für sie und ihre Nachkommen war, wie verwandtschaftliche Beziehungen ausgehandelt wurden und wie Verwandtsein und Herrschen in der Praxis zusammenhingen. Was war eine Königinmutter, ein königlicher Sohn oder eine königliche Schwester? Die Briefe, die sich Mutter und Kinder schrieben, machen Verwandtschaft als flexibles Repertoire politischen Denkens und Handelns sichtbar. In einer Epoche, die als Entstehungszeit moderner Staaten betrachtet wird, wurde so Königsherrschaft in verwandtschaftlichen Beziehungen immer wieder neu konzeptualisiert und legitimiert.
Marie Luise Gotheins "Geschichte der Gartenkunst" : Das Bild des Gartens als Text
Marie Luise Gothein verfasste 1914 mit ihrer „Geschichte der Gartenkunst“ einen Klassiker, der bis heute zwar übersetzt und neuaufgelegt, nie jedoch als Grundlagenwerk in den Fokus gerückt wurde. Diese Arbeit untersucht die intellektuellen und ästhetischen Konzepte der Autorin im Hinblick auf ihre Darstellung der Gartenkunst. Welchen Prämissen folgt die Kulturwissenschaftlerin bei der Fixierung des stets im Wandel begriffenen Raumkunstwerks Garten in Text und Bild? Welche Rolle spielt die Reformgartenbewegung, die zur Zeit der Veröffentlichung in vollem Gange war? Die Analyse von Gotheins Gartenbeschreibungen, etwa der Villa d’Este, zeigt, wie grundlegend die Geschichtsschreibung von den Herausforderungen der Zeit beeinflusst ist: Im Sinne des Ecocriticism spiegeln die Bände die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Gartenbuchpreis 2021 in der Kategorie Bestes Buch über Gartengeschichte.
Kreuzzug als Selbstbeschreibung : Burgundische Statuspolitik in den spätmittelalterlichen Traktaten des Jean Germain
Die Geschichte der Valois-Herzöge von Burgund kann aus der Retrospektive zu einer Gegenüberstellung von modernen und mittelalterlichen Elementen dieser Herrschaftsbildung verleiten. Insbesondere die Kreuzzugspläne Philipps des Guten (1419–1467) erscheinen vor dieser Folie wie das letzte Aufblühen einer mittelalterlichen Kultur, die nicht recht zum klassischen Narrativ eines »burgundischen Staates« passen will. Statt in Philipp aber einen Don Quijote des 15. Jahrhunderts oder den Vorläufer des »letzten Ritters« Maximilian zu sehen, untersucht die Studie seine Kreuzzugsprojekte als Bestandteil einer burgundischen Statuspolitik: Die ostentative Bereitschaft zur Verteidigung des Glaubens erlaubte der jungen Dynastie, eine Höherrangigkeit im Kreis der europäischen Fürsten zu beanspruchen. Zur Analyse des burgundischen Kreuzzugsdiskurses stützt sich die Arbeit auf drei Traktate des Jean Germain († 1461), die er als Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies verfasste. Methodologisch betritt sie dabei Neuland, indem eine sequenzanalytische Methode der rekonstruktiven Sozialforschung mit einer diskursanalytischen Perspektive verbunden und zur Untersuchung spätmittelalterlicher Handschriften herangezogen wird.
Islamische Selbstbilder: Festschrift für Susanne Enderwitz
In der Islamkunde wird seit einigen Jahren sehr lebhaft diskutiert, inwieweit „Horizonte des Individuellen“ in literarischen und dokumentarischen Quellen wahrnehmbar sind. Der Band ist bewusst nicht als kumulativ strukturierte Festgabe konzipiert, sondern soll vielmehr an fachwissenschaftlich relevante Diskussionen anknüpfen. Mit Beiträgen von Lale Behzadi, Michael Ursinus, Henning Sievert, Paula Schrode, Johannes Zimmermann, Ines Weinrich u.v.a.
Zur Negation im Gegenwartsdeutschen und im Modernen Hocharabisch: Eine linguistisch-kontrastive Untersuchung
Die vorliegende Arbeit ist eine kontrastive, empirisch fundierte Untersuchung der Negationsausdrücke nicht im Gegenwartsdeutschen (GWD) und laysa, lam, lan, lammā, lāta, lā und mā im Modernen Hocharabisch (MHA). Vier Aspekte werden vergleichend analysiert: (i) die morphologische Verschmelzung der Negationsausdrücke mit Indefinita im GWD und mit klitischen Partikeln/Suffixen im MHA; im MHA entsteht ein Paradigma von Negationsausdrücken ähnlich einem Hilfsverb-Paradigma; (ii) die Stellung der genannten Ausdrücke in Satzstrukturen; (iii) die Interaktion zwischen Negationsausdrücken und verbalen oder nominalen Kategorien und (iv) die Interaktion zwischen Negation und Informationsstruktur. Zwei Romane wurden als Datengrundlage gewählt: „Sommerstück“ (1989) von Christa Wolf für das GWD und „Bayna al-Qasrayn“ (dt. „Zwischen den Palästen“) (1956) von Naǧib Maḥfūẓ für das MHA. Ziel der Studie ist es, die grammatische Organisation der Negation in beiden Sprachen zu beschreiben und zu vergleichen.
» Ruine d'estat «: Sicherheit in den Debatten der französischen Religionskriege 1557–1589
Sicherheit – ein für die französischen Religionskriege ebenso zentrales wie noch weitgehend unerforschtes Thema. Christian Wenzel analysiert Vorstellungen von Sicherheit sowie ihre Funktion in den französischen Religionskriegen erstmals systematisch und mit Blick auf zeitgenössische Deutungsmuster. Anschaulich zeichnet die Studie eine breite Sicherheitsdebatte nach, die die Konflikte zwischen 1557 und 1589 maßgeblich prägte. Das ermöglicht nicht nur eine neue Perspektive auf zentrale Ereignisse und Prozesse, sondern leistet mit dem hier entwickelten Konzept der »historischen Sicherheitskommunikation« auch einen Beitrag zur historischen Sicherheitsforschung und zeigt die Vielschichtigkeit frühneuzeitlicher Sicherheitsvorstellungen.
»Cette reine qui fait une si piètre figure«: Maria von Medici in der europäischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts
Die französische Königin Maria von Medici (1575–1642) blieb der Nachwelt als unfähig, machtbesessen und mutmaßliche Gattenmörderin in Erinnerung. Ihr kulturelles und politisches Wirken wurde in der Geschichtsschreibung häufig zu einer weiblichen und italienischen Klammer zwischen der Herrschaft Heinrichs IV. und dem Ministeriat Richelieus reduziert. Dieses Bild überdauerte die Revolution von 1789 und verfestigte sich im identitätsstiftenden historischen Diskurs einer sich zunehmend bürgerlich, republikanisch und laizistisch definierenden französischen Nation.
Die bewegte Rezeption der zweiten Medici-Regentin im 19. Jahrhundert ist hier erstmals Gegenstand einer Untersuchung. Sie bietet tiefe Einblicke in die Verquickung von Historiographie, Gesellschaft und Politik in der europaweiten Krisen- und Umbruchszeit des Nationalismus.
Il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato (1914–1930)
Der berühmte Jurist Pietro Gasparri (1852–1934), ein anerkannter Universitätslehrer und erfahrener päpstlicher Diplomat, leitete das Staatssekretariat und die römische Kurie vom November 1914 bis zum Januar 1930 in einer für die Geschichte Europas und des Papsttums entscheidenden Epoche. Der Band ist das Ergebnis einer Reihe von Studienseminaren zur internationalen Politik des Heiligen Stuhles, die 2013 bis 2016 von der Università Europea di Roma und dem Institut catholique de Paris gemeinsam durchgeführt wurden. Er versammelt die Beiträge eines internationalen Kreises von jüngeren und gestandenen Historiker*innen und Archivist*innen, in denen es um Gasparri in seiner Rolle als Staatssekretär und als zentrale Figur für die Regierung der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert geht.
»Es ist nur ein Dorf« : Schwetzingen mit den Augen Leopold Mozarts. Begleitpublikation zur Ausstellung im Karl-Wörn-Haus, Museum der Stadt Schwetzingen, vom 28. April – 28. Juli 2019 aus Anlass des 300. Geburtstages des Komponisten
Der vorliegende Band, der begleitend zur gleichnamigen Ausstellung entstand, ehrt Leopold Mozart (1719-1787), der nicht nur Musiker, Komponist und Pädagoge war, sondern auch ein gut informierter Beobachter seiner Zeit. Seine Briefe enthalten zahlreiche Details zu musik- und kulturgeschichtlichen Themen, seine Aufzeichnungen über den Aufenthalt in der kurpfälzischen Sommerresidenz Schwetzingen sind von unschätzbarem Wert. Diesen Informationen gehen die Autoren nach, setzen sie in Beziehung zu dem Wissen ihrer jeweiligen Disziplinen. So entsteht ein umfassendes Bild der kurpfälzischen Sommerresidenz des Jahres 1763, einem musikhistorischen Brennpunkt im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts.
Caring for Old Age: Perspectives from South Asia
Neben zunehmender Urbanisierung und Mobilität erleben viele Gesellschaften gleichzeitig steigende Lebenserwartungen und ein Älterwerden ihrer Gesamtbevölkerung. Solch grundlegende demografische und strukturelle Veränderungen spiegeln sich in einer Vielzahl von Narrativen und Strategien wider, wie ein „gutes Alter(n)“ angesichts sich rapide transformierender Umgebungen, der Mobilität von Menschen und sich wandelnder sozialer Beziehungen aussehen kann. Dieser Band erforscht die transkulturellen Dimensionen von Alter(n) und Care in ethnografischen und literarischen Fallstudien sowohl in Südasien als auch in einer südasiatischen Studie in Europa. Die elf Beiträge dieses Bandes setzen sich kritisch mit eurozentrischen Aspekten in der Alter(n)sforschung auseinander und untersuchen, wie Perspektiven aus dem Globalen Süden transkulturelle Verflechtungen und Konnektivitäten von Care- und Alter(n)serfahrungen aufzeigen können.
Musiktheater im höfischen Raum des frühneuzeitlichen Europa: Hof – Oper – Architektur
Die Vereinigung der Künste im „Gesamtkunstwerk“ der höfischen Oper bildete zwar schon wiederholt den Gegenstand musikwissenschaftlicher Forschungen, doch wurde beispielsweise die spezifisch räumlich-architektonische Seite der höfischen Oper bislang kaum beachtet. Musiktheater meint aber szenische Aufführung und Architektur gleichermaßen. Beide bildeten wesentliche Komponenten herrschaftlicher Repräsentation im 17. und 18. Jahrhundert. Im Alten Reich veranlasste daher nicht nur der reichsständische Adel musiktheatrale Aufführungen, sondern auch kleinere Höfe brachten Ballette und Opern auf die Bühne. Die interdisziplinären Beiträge einer Tagung des Rudolstädter Arbeitskreises zur Residenzkultur widmen sich dem Thema in einer europäischen Perspektive und erläutern die vielfältigen Verbindungen, die zwischen dem Musiktheater und dem höfischen Raum im architektonischen, politisch-kulturellen sowie sozialen Sinn bestanden.
Der Architekt in der Frühen Neuzeit: Ausbildung, Karrierewege, Berufsfelder
Der Beruf des Architekten durchlief im Heiligen Römischen Reich bereits in der Frühen Neuzeit (ca. 1500–1800) die entscheidenden Stadien seiner Professionalisierung. In der Regel bereiteten mehrfache Ausbildungen im künstlerischen, handwerklichen, militärischen und wissenschaftlichen Bereich die Architekten auf ein breites Berufsfeld vor. Als Baumeister in den Bauämtern führten sie eine effiziente Arbeitsteilung bei Entwurf, Planung, Ausführung und Verwaltung ein und konnten zuweilen bemerkenswerte Karrieren durchlaufen. In diesem Band werden die kulturellen, sozialen und administrativen Faktoren beleuchtet, die das künstlerische Schaffen der Architekten bedingten.
Melchior Goldast und der ›Codex Manesse‹: Mit besonderer Berücksichtigung der ›Hypomnemata in aulicorum Poetarum Carmina amatoria‹
In der Zeit um 1600 setzt sich der Schweizer Humanist und Jurist Melchior Goldast von Haiminsfeld (1576/78–1635) intensiv mit der Literatur des Mittelalters auseinander. Seine besondere Aufmerksamkeit findet die bedeutendste mittelalterliche Lyrikhandschrift in deutscher Sprache, der ›Codex Manesse‹. Goldast fertigt umfangreiche Notizen zu der Handschrift an, zitiert und ediert sie in Teilen in seinen gedruckten Werken und macht sie so erstmals einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Mehr als die Begeisterung für die Lyrik des Mittelalters sind es aber vor allen Dingen tagespolitische Wirkinteressen, die den Calvinisten Goldast bei seiner Arbeit antreiben.
Testing the Margins of Leisure: Case Studies on China, Japan, and Indonesia
Dieser Band vereint acht Studien zu verschiedenen historischen und aktuellen Aspekten von Freizeit in Asien. Er setzt sich kritisch mit dem vorherrschenden eurozentrischen Schwerpunkt der Freizeitforschung auseinander und bringt eine Reihe von zentralen Fragen wie etwa die Rolle der Freizeit als transkultureller Kontaktzone in die Diskussion mit ein. Der Band beschäftigt sich mit einem Gebiet, das aufgrund der verstärkten Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die Definition der Identität einer Person, der sich verwischenden Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit im postindustriellen Zeitalter und der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Freizeitaktivitäten wie dem Tourismus rasch wächst. Die Einbeziehung Asiens in die Diskussion trägt dazu bei, das Freizeitforschung in einen globalen Kontext zu stellen.
General Relativity
Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist nach wie vor die gültige Theorie der Gravitation und hat sich in zahlreichen Tests und Messungen bewährt. Sie beruht auf einfachen Prinzipien und verbindet die Geometrie der Raumzeit mit deren Masse-Energie-Inhalt. In diesem Vorlesungsskript werden zunächst die physikalischen Grundlagen erläutert und die nötigen differentialgeometrischen Werkzeuge bereitgelegt. Nach der Begründung der Feldgleichungen wird die Bewegung im Gravitationsfeld besprochen und gezeigt, welche Eigenschaften schwacher Gravitationsfelder aus den Feldgleichungen folgen. Lösungen für kompakte Objekte und schwarze Löcher werden hergeleitet und diskutiert, ebenso wie kosmologische Modelle. Zwei astrophysikalische Anwendungen der allgemeinen Relativitätstheorie schließen das Skript ab.
Heinrich Zoepfl (1807–1877): Heidelberger Universitätsprofessor und Rechtsgutachter
Heinrich Zoepfl (1807-1877), Heidelberger Professor für Rechtsgeschichte und Staatsrecht, wirkte in den bewegten Zeiten des „Vormärz“, der „deutschen Revolution“ von 1848/49 und der Reichsgründung 1870/71. Er nahm an allen Ereignissen lebhaften Anteil, sowohl im Hörsaal und in seinen Schriften, in der Ersten badischen Kammer und im Erfurter Unionsparlament, als auch durch eine ausgebreitete Tätigkeit als Gutachter. Als solcher beriet er die Regierung in Karlsruhe, Betroffene von politischer Repression, Städte, Parlamente und Einzelpersonen, besonders aber zahlreiche „mediatisierte“ Adelshäuser, die nicht nur ihren politischen Machtverlust zu verkraften, sondern auch viele interne Rechtsfragen zu lösen hatten. Stets wurde Zoepfl als Kenner adeligen Standesrechts gefragt.
Der Band bietet erstmals ein Verzeichnis von Zoepfls ungedruckten und gedruckten Gutachten, Kommissionsberichten und Werken, die sich in der Universitätsbibliothek Heidelberg befinden, und ermöglicht einen direkten Zugang zu den digitalisierten Quellen. Auf ein Lebensbild und eine Würdigung seiner Lehrbücher folgen Abhandlungen zu ausgewählten Gutachten sowie historische Querschnitte zur politischen Lage in Zoepfls Lebenszeit.
Latin and Arabic: Entangled Histories
Latein und Arabisch haben als Sprachsysteme mit einer großen Vielfalt an schriftlichen und mündlichen Registern, darunter “Sprachen” und Dialekte”, in der Geschichte des Euromediterraneums seit der Antike eine herausragende Rolle gespielt. Aufgrund ihrer lang anhaltenden Funktion als Sprachen der Administration, intellektueller Aktivität und Religion, werden sie oft als kultureller Marker Europas und der arabisch-islamischen Sphäre betrachtet. Dieser Band untersucht die vielen Facetten lateinisch-arabischer Verflechtung aus makro- und mikrohistorischer Perspektive. Er stellt die binäre Opposition von “Islam” und “dem Westen” in Frage und hebt die sprachliche Dimension christlich-muslimischer Beziehungen hervor.
Geschichte der Physik an der Universität Heidelberg
Mehr als 600 Jahre Physik und Astronomie an der Universität Heidelberg: vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart, vom Studium der Physik des Aristoteles bis zu den Experimenten an den Beschleunigern in Genf. Der Weg zu der nach der Zahl der Studierenden größten Physikfakultät Deutschlands war steinig: So musste die Universität im Dreißigjährigen Krieg zeitweise schließen; während des Nationalsozialismus wurde das Physikalische Institut Zentrum einer „Deutschen Physik“. Doch die Sternstunden überwiegen: darunter die Entzifferung des Spektrums des Sonnenlichtes durch Kirchhoff und Bunsen und Jensens Entdeckung der Schalenstruktur der Atomkerne, für die er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
The Psychology of Human Thought: An Introduction
„Psychology of Human Thought“ ist eine Sammlung frei zugänglicher, qualitätsgeprüfter Kapitel aus allen Gebieten höherer Kognition. Sie ist gedacht als Lesebuch zum Studium komplexer Kognition und des menschlichen Denkens. Die Kapitel umfassen die Themen Begriffserwerb, Wissensrepräsentation, induktives und deduktives Schließen, Problemlösen, Metakognition, Sprache, Kultur, Expertise, Intelligenz, Kreativität, Weisheit, Denkentwicklung, Denken und Gefühle. Auch Kapitel zur Geschichte und zu Methoden sind dabei. Die Kapitel sind von weltweit führenden Experten aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Israel, Australien und Deutschland verfasst. Das Niveau ist ausgerichtet auf fortgeschrittene Studierende.
Modeling the Pāṇinian System of Sanskrit Grammar
Die vorliegende Arbeit untersucht aus einer neuen Perspektive Pāṇinis Aṣṭādhyāyī. Es versucht, Pāṇinis Regelwerk der Sanskrit-Grammatik aus formaler Sicht zu erforschen und die Möglichkeiten zu untersuchen, es logisch, explizit und konsistent darzustellen. Dazu wird ein geeignetes Framework für eine solche Repräsentation vorgeschlagen. Im Unterschied zur Aṣṭādhyāyī, die in einer künstlichen, aber natürlichen Sprache verfasst ist und für Personen konzipiert war, die sowohl mit der Sanskrit-Sprache als auch mit grammatischen Techniken vertraut sind, zielt die vorliegende Darstellung auf eine nonverbale Repräsentation in Form von mathematischen Kategorien und logischen Beziehungen ab, die algorithmisch umgesetzt werden können.
Der in dieser Arbeit vorgeschlagene formale Rahmen würde geeignete Werkzeuge bereitstellen, um Hypothesen zum grammatischen System zu postulieren und zu evaluieren. Darüber hinaus würde er die Grundlage für eine computergestützte Implementierung der Grammatik schaffen. Beide Aspekte sind Forschungsgegenstand im Bereich der theoretischen Studien zu Pāṇini sowie der neu entstehenden Disziplin der Sanskrit-Computerlinguistik. Dieses Buch beschäftigt sich mit der Grundlagenarbeit in diesen Bereichen.
The Scholar’s Choice: Lieblingsstücke Heidelberger Wissenschaftler aus dem Völkerkundemuseum der von Portheim-Stiftung. Eine Ausstellung anlässlich der Eröffnung des Centrums für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien (CATS)
Der Band, der aus einer gleichnamigen Ausstellung hervorgegangen ist, umfasst siebzehn Objekte aus dem Völkerkundemuseum der von Portheim-Stiftung Heidelberg, die verschiedene Themen des Lebens ansprechen: die Liebe, die Verstellung durch Masken oder Schmuck, die Religion, die Musik, das Essen, das Messen und Wiegen, das Buch, die Waffen, die Reise, die Herrschaft, den Tod. Ausgewählt wurden die Objekte als ihre Lieblingsstücke von Heidelberger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dem 2019 eröffneten Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien verbunden sind.
Patterns of Symbolic Violence: The Motif of ‘Gypsy’ Child-theft across Visual Media
Anhand einer Reihe paradigmatischer Kunstwerke untersucht das Buch das Motiv des „Zigeuner“-Kinderraubs und dessen Visualisierungen. Im Vordergrund steht die Analyse der Farbkodierung von Körpern und deren rassistische bzw. antiziganistische Verwendung. Die Autorin nimmt eine Bestandsaufnahme der Anpassungen des Motivs in verschiedenen visuellen Medien vor und arbeitet seine vielschichtigen Bedeutungen und Funktionen heraus. Die Analyse beginnt mit einer kritischen Betrachtung von Cervantes Erzählung „La gitanilla“. Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind die holländischen Historienmalereien des 17. Jahrhunderts und die neu aufkommende Drucktechnik im 19. Jahrhundert. Den Abschluss bildet eine annotierte Filmografie, die 49 Werke umfasst.
Drawing Education – Worldwide! Continuities – Transfers – Mixtures
Zeichnen war von der Frühen Neuzeit bis in die Moderne als Kulturtechnik fest in der Lebenswirklichkeit der europäischen Gesellschaft verankert. Der vorliegende Band fragt ausgehend von dieser Tatsache erstmals nach dem Stellenwert des Zeichnens auch in anderen Kulturräumen. Indigene Verfahren des Zeichnens und Zeichnen-Lernens im arabischen, asiatischen, im latein- bzw. nordamerikanischen und auch europäischen Raum werden ebenso adressiert wie auch historische Transferprozesse didaktischer Methoden, ästhetischer Normen und ausbildender Institutionen des Zeichenunterrichts.
Show & Tell. Studierende bieten Einblick in die Privatsammlung Erik Jayme: Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg und des Instituts für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg
Zu den Tätigkeiten von KunsthistorikerInnen gehört es, einer Öffentlichkeit ausgewählte Kunstwerke zu präsentieren. Üblicherweise besteht erst im Berufsleben die Möglichkeit, die entsprechenden Erfahrungen zu machen und so die notwendigen Fertigkeiten zu erlernen. In einem Seminarprojekt des Instituts für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg bekamen die Studierenden demgegenüber einmal die sonst seltene Möglichkeit, bereits im Studium eine eigene Ausstellung zu organisieren: Sie konnten aus der Privatsammlung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme frei Kunstwerke auswählen und zu einer in der Universitätsbibliothek Heidelberg gezeigten Ausstellung zusammenstellen.
Die Ausstellung Show & Tell. Studierende bieten Einblick in die Privatsammlung Erik Jayme ist vom 15.05.2019 bis 16.02.2020 in der Universitätsbibliothek Heidelberg zu sehen.
Coptica Palatina: Koptische Texte aus der Heidelberger Papyrussammlung (P.Heid.Kopt.). Bearbeitet auf der Vierten Internationalen Sommerschule für Koptische Papyrologie Heidelberg, 26. August – 9. September 2012
Die Beiträge des Bandes „Coptica Palatina“ sind im Rahmen einer Internationalen Sommerschule für koptische Papyrologie von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter der Anleitung der Herausgeber erarbeitet worden. Es werden kommentierte und übersetzte Editionen von koptischen literarischen und magischen Texten sowie von Briefen, Rechtsurkunden und Verwaltungsschreiben vorgelegt, die aus verschiedenen Regionen Mittel- und Oberägyptens (Faijum, Hermupolis, Bawit, Aphrodito, Esna, Apollonopolis magna) stammen und vom 6./7. bis ins 11./12. Jh. n. Chr. datieren. Das Schwergewicht der Texte liegt im 7./8. Jh., der Zeit der Transformation der byzantinischen Provinz in eine Provinz des frühislamischen Kalifats.
Religion and Aesthetic Experience: Drama—Sermons—Literature
Die Religionsästhetik hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung innerhalb der Religions- und Islamwissenschaft gewonnen. Dieser Band betont die transkulturellen Dimensionen der theoretischen Grundlagen der Religionsästhetik und bietet Fallstudien über die Rolle ästhetischer Erfahrung in religiösen Kontexten. Diese umfassen islamische Predigten im Nahen Osten und Südasien, islamische religiöse Gesänge, ein Korankapitel, einen deutschen Performance-Künstler, indische rasa-Theorie und arabische wie bengalische Literatur. Zusammen zeigen die Autoren die Fruchtbarkeit der Analyse ästhetischer Formen von religiöser Vermittlung über verschiedene Regionen und Gattungen hinweg auf.
Die goldenen Siegelringe der Ägäischen Bronzezeit
Aufgrund ihres hohen Materialwerts und ihrer aussagekräftigen Ikonographie fanden ägäische Siegelringe in der Forschung bereits mehrfach Beachtung. Dabei stand häufig die Analyse und Interpretation der Bilder im Fokus. Eine Gesamtbetrachtung dieser äußerst komplexen archäologischen Gattung und ihrer vielfältigen Funktionen innerhalb der minoisch-mykenischen Administration und Gesellschaft fehlte jedoch bisher. In der vorliegenden Arbeit werden erstmalig nicht nur erhaltene Ringe, sondern auch Abdrücke goldener Siegelringe auf Tonplomben systematisch untersucht, was ein neues Verständnis der Gattung und deren Wandel im Laufe der Ägäischen Bronzezeit ermöglicht.
Lineare Optimierung: Numerik linearer und konvexer nichtlinearer Optimierungsaufgaben
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines mehrsemestrigen Zyklus „Numerische Mathematik“, die der Autor an den Universitäten Saarbrücken und Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden Band werden die Konzepte numerischer Verfahren zur Lösung linearer Optimierungsaufgaben (sog. „Lineare Programme“) entwickelt. Dazu gehören neben dem klassischen „Simplex-Verfahren“ insbesondere auch modernere „Innere Punkte-Methoden“. Als naheliegende Weiterungen werden auch Methoden für konvexe nichtlineare, speziell quadratische Optimierungsaufgaben diskutiert. Dabei finden sowohl theoretisch-mathematische als auch praktische Aspekte Berücksichtigung. Das Verständnis der Inhalte erfordert nur solche Vorkenntnisse, wie sie üblicherweise in den Grundvorlesungen über Analysis, Lineare Algebra und Numerik vermittelt werden. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen theoretische und praktische Übungsaufgaben mit Lösungen im Anhang.
Arbeit. Wohnen. Computer.: Zur Utopie in der bildenden Kunst und Architektur der DDR in den 1960er Jahren
Im Spannungsfeld zwischen Macht- und Wahrheitsanspruch der SED und dem subjektiven Eigensinn der Kunstwerke und ihrer SchöpferInnen entfalteten sich in den 1960er Jahren zwischen Mauerbau (1961) und Machtwechsel (Ulbricht / Honecker 1971) Debatten um die Frage nach Gestaltung und Erscheinungsbild eines zukünftigen, technologisch hoch entwickelten und wissenschaftlich fundierten Sozialismus. Arbeit. Wohnen. Computer. spürt anhand von Fragen nach dem Aussehen des Arbeiters der Zukunft, nach dem Wohnen der Zukunft sowie nach der Bedeutung des Computers in der Zukunft diesen Vorstellungswelten sozialistischer Wunschräume und Wunschzeiten in Bild, Bau und Wort nach.
Reshaping Glocal Dynamics of the Caribbean: Relaciones y Desconexiones, Relations et Déconnexions, Relations and Disconnections
Die Zirkumkaribik und ihre Diaspora ist eine Region der Beziehungen und Brüche, die historisch als Sprungbrett der europäischen Eroberung Amerikas und Umschlagplatz von Menschen, Ideen und Waren sowie als Experimentierfeld moderner sozialer, politischer und ökonomischer Produktionsformen diente. Heute stellt sich die Region als gemeinsamer kultureller, multilingualer Raum des Zusammenlebens dar, der aber auch durch unterschiedliche Kolonial- und Widerstandsgeschichten von Dissonanzen, Brüchen und Insularitäten geprägt ist. Dieser interdisziplinäre, dreisprachige Band untersucht die Zirkulation von Wissensbeständen und Archiven in der glokalen Wissensproduktion in und über die Karibik und zielt auf eine klarere Vorstellung darüber, wer wie bzw. womit welche Karibik entwirft. Die 33 Beiträge beschäftigen sich mit fünf transversalen Themen: (1) Akademische und künstlerische Annäherungen (2) Kunst und Visuelle Studien, (3) Umwelt und Nachhaltigkeit, (4) Migration und Wissenszirkulation, (5) Verschränkte Geschichte(n) und Erinnerungen.
Numerical Linear Algebra
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines mehrsemestrigen Zyklus ”Numerische Mathematik“, die der Autor an den Universitäten Saarbrücken und Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden Band werden die Konzepte numerischer Verfahren zur Lösung linearer Optimierungsaufgaben (sog. ”Lineare Programme“) entwickelt. Dazu gehören neben dem klassischen ”Simplex-Verfahren“ insbesondere auch modernere ”Innere Punkte-Methoden“. Als naheliegende Weiterungen werden auch Methoden für konvexe nichtlineare, speziell quadratische Optimierungsaufgaben diskutiert. Dabei finden sowohl theoretisch-mathematische als auch praktische Aspekte Berücksichtigung. Das Verständnis der Inhalte erfordert nur solche Vorkenntnisse, wie sie üblicherweise in den Grundvorlesungen über Analysis, Lineare Algebra und Numerik vermittelt werden. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen theoretische und praktische Übungsaufgaben mit Lösungen im Anhang.
Museen digital: Eine Gedächtnisinstitution sucht den Anschluss an die Zukunft
Insbesondere Museen im angelsächsischen Bereich verstehen immer besser, dass sie sich in einer medial modernen Form präsentieren müssen, wenn sie auch ein jüngeres Publikum für sich einnehmen wollen. Internet, soziale Medien, Virtual und Augmented Reality, Open Culture: das sind Schlagworte, die auch im Museumskontext immer mehr Bedeutung erlangen. In diesem Buch werden Kunstmuseen vorgestellt, die sich dem Digitalen auf besonders kreative Weise nähern und damit sowohl ihrem Bildungs- als auch ihrem Unterhaltungsauftrag gerecht zu werden versuchen.
Entre mers—Outre-mer: Spaces, Modes and Agents of Indo-Mediterranean Connectivity
Meeresräume haben sich zu einem dynamischen Feld der heutigen Geschichtsforschung entwickelt. Dabei steht jedoch die Untersuchung von Verbindungen zwischen Meeren (entre mers) und Vorstellungen von Land „Outre-mer“ bislang weniger im Zentrum des Interesses. Diesen Fragen widmet sich die Aufsatzsammlung, die auf eine Tagung an der Universität Heidelberg zurückgeht. Die Beiträge behandeln Aspekte transmariner Verbindungen, ihrer Regulierung und mentalen Ausweitung in einem indo-mediterranen Kontext, der neben dem Mittelmeer und dem Indischem Ozean auch die Projektionen von Seewegen nach Indien auf andere maritime Räume in einem breiten zeitlichen Rahmen vom ägyptischen Altertum bis zum Beginn des atlantischen Zeitalters im 16. Jahrhundert umfasst.
Analysis 3: Integralsätze, Lebesgue-Integral und Anwendungen
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines dreisemestrigen Kurses "Analysis", den der Autor an der Universität Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden dritten Teil wird die Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer und mehrerer reeller Variablen weiterentwickelt in Richtung auf Riemann-Integrale über Kurven und Flächen und die Integralsätze von Gauß und Stokes. Weiter werden der Lebesguesche Integralbegriff sowie die darauf aufbauenden Funktionenräume eingeführt. Die so gewonnenen Methoden werden dann in der Theorie der Fourier-Integrale sowie für einfache Variationsaufgaben und partielle Differentialgleichungen angewendet. Stoffauswahl und Darstellung orientieren sich dabei insbesondere an den Bedürfnissen der Anwendungen in der Theorie von Differentialgleichungen, der Mathematischen Physik und der Numerik. Das Verständnis der Inhalte erfordert neben dem Stoff der vorausgehenden Bände "Analysis 1 (Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Veränderlichen)", und "Analysis 2 (Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer reeller Veränderlichen)" nur Grundkenntnisse aus der Linearen Algebra. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen Übungsaufgaben zu den einzelnen Kapiteln mit Lösungen im Anhang.
Analysis 2: Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer reeller Veränderlichen
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines dreisemestrigen Kurses „Analysis“, den der Autor an der Universität Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden zweiten Teil wird die klassische Differential- und Integralrechnung reeller Funktionen in mehreren Dimensionen entwickelt. Stoffauswahl und Darstellung orientieren sich dabei insbesondere an den Bedürfnissen der Anwendungen in der Theorie von Differentialgleichungen, der Mathematischen Physik und der Numerik. Das Verständnis der Inhalte erfordert neben dem Stoff des vorausgehenden Bandes „Analysis 1 (Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Veränderlichen)“ nur Grundkenntnisse aus der Linearen Algebra. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen Übungsaufgaben zu den einzelnen Kapiteln mit Lösungen im Anhang.
Grammar and Corpora 2016
Die Verfügbarkeit großer annotierter und durchsuchbarer Korpora, verbunden mit einem neuerwachten Interesse an der empirischen Grundlegung und Validierung linguistischer Theorie und Beschreibung, hat in letzter Zeit zu einer regelrechten Welle interessanter Arbeiten zur Grammatik natürlicher Sprachen geführt. Dieser Band präsentiert zum einen neuere Entwicklungen in der korpusorientierten Forschung zur Grammatik germanischer, romanischer und slawischer Sprachen und zum anderen innovative Ansätze in der einschlägigen korpuslinguistischen Methodologie, die auch Anwendung im Umfeld der Grammatik finden. Der Band fasst die Beiträge der sechsten internationalen Konferenz Grammar and Corpora zusammen, die im November 2016 am Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim stattfand.
Die Herausgeber sind wissenschaftliche Mitarbeiter am IDS und waren Organisatoren von Grammar and Corpora 2016.
Die Kunst der Narkose: Geschichte der Heidelberger Anästhesiologie. Festschrift anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Ordinariats für Anästhesiologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2017
Die Heidelberger Anästhesiologie blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte zurück. Sie beginnt mit den ersten – zunächst noch der Chirurgie untergeordneten – „Narkose-Pionieren“ im 19. Jahrhundert und mündet in ein eigenständiges Fachgebiet mit eigenem 1967 gegründeten Ordinariat. Die Entwicklung der modernen Anästhesiologie ist beeindruckend: Heute bildet die sie einen zentralen Zweig in der Medizin, zu dem auch die Intensiv-, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin zählen und in dem die verschiedenen operativen und nicht-operativen Fachbereiche miteinander vernetzt sind. Die Anästhesiologie steht angesichts der modernen medizinischen und demografischen Entwicklung vor der Herausforderung, immer ältere und schwerer erkrankte Menschen einer Operation unterziehen zu müssen und den Spagat zwischen individuellen Bedürfnissen einerseits, Ökonomisierung und Kommerzialisierung der Medizin andererseits zu meistern.
Visualisierung sprachlicher Daten: Visual Linguistics – Praxis – Tools
Visualisierungen spielen in den Wissenschaften eine wichtige Rolle im Forschungsprozess. Sie dienen der Illustration von gewonnener Erkenntnis, aber auch als eigenständiges Mittel der Erkenntnisgewinnung.
Auch in der Linguistik sind solche Visualisierungen bedeutend. Beispielsweise in Form von Karten, Baumgraphen und Begriffsnetzen. Bei korpuslinguistischen Methoden sind explorative Visualisierungen oft ein wichtiges Mittel, um die Daten überblickbar und interpretierbar zu machen.
Das Buch reflektiert die theoretischen Grundlagen wissenschaftlicher Visualisierungen in der Linguistik, zeigt Praxisbeispiele und stellt auch Visualisierungswerkzeuge vor.
----
Die Forschungsdaten zum Beitrag von Wolfer/Hansen-Morath: "Visualisierung sprachlicher Daten mit R" sind abrufbar unter https://doi.org/10.11588/data/6SO6TG.
Süddeutsche Hofkapellen im 18. Jahrhundert: Eine Bestandsaufnahme
Im 18. Jahrhundert waren die Fürstenhöfe neben den Kirchen die wichtigsten Träger des Musiklebens. Gemessen an der Bedeutung der Hofkapellen ist ihre Geschichte nur unzureichend erforscht. Es liegt zwar eine ganze Reihe von Spezialuntersuchungen zu einzelnen Höfen vor, doch fehlen nach wie vor vergleichende Untersuchungen.
Die vorliegende Publikation dokumentiert den gegenwärtigen Stand der Forschung zu den wichtigsten Hofkapellen sowie zu ausgewählten kleineren Adelskapellen im süddeutschen Raum.
Studies in Historical Documents from Nepal and India
Dieser Sammelband enthält Beiträge zur Konferenz „Studying Documents in Premodern South Asia and Beyond: Problems and Perspective“, die im Oktober 2015 in Heidelberg stattfand. Experten aus unterschiedlichen Fächern – der Indologie, Tibetologie, Geschichtswissenschaft, Ethnologie, Religionswissenschaft und Digital Humanities – beleuchten Themen wie Diplomatik und Typologie von Dokumenten, ihren Stellenwert gegenüber anderen Texten und Textgattungen, Archivierungs- und Editionsmethoden sowie ihr „soziales Leben“, d. h. ihre Rolle in sozialen, religiösen und politischen Konstellationen, die Akteure und Praktiken ihrer Herstellung und Nutzung sowie die Normen und Institutionen, die sie verkörpern und konstituieren.
Das Buch ist der erste Band der Reihe Documenta Nepalica – Book Series, welche von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem nepalesischen Nationalarchiv herausgegeben wird.
Analysis 1: Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Veränderlichen
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines dreisemestrigen Zyklus „Analysis“, die der Autor an der Universität Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden ersten Teil wird die klassische Differential- und Integralrechnung reeller Funktionen einer Veränderlichen entwickelt. Stoffauswahl und Darstellung orientieren sich dabei insbesondere an den Bedürfnissen der Anwendungen in der Theorie von Differentialgleichungen, der Mathematischen Physik und der Numerik. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen Übungsaufgaben zu den einzelnen Kapiteln mit Lösungen im Anhang.
Die Alte Aula der Universität Heidelberg
Die Aula der Alten Universität ist Festsaal und Herzkammer der Ruperto Carola und veranschaulicht in Allegorien und Metaphern Geschichte und Selbstverständnis der ältesten Universität im heutigen Deutschland. Ursprünglich in barocker Ausgestaltung erbaut, wurde sie zum 500. Bestehen der Universität komplett umgestaltet. Der vom Großherzog von Baden gestiftete prachtvolle Raum präsentiert sich heute als eines der wenigen intakt erhaltenen Ensembles der Karlsruher Holzschnitzschule und wird überwiegend für akademische Feiern wie Antrittsvorlesungen neuberufener Professoren oder Absolventenfeiern genutzt. Die Aula ist jedoch auch ein Ort für öffentliche Konzerte und Vorträge, denen das ehrwürdige Ambiente dieses Saals einen besonderen Glanz verleihen soll.
Transcultural Encounters in the Himalayan Borderlands: Kalimpong as a “Contact Zone”
Die vorliegende Studie untersucht Kalimpong und die umliegenden Grenzgebiete des östlichen Himalaja als paradigmatischen Fall einer “Kontaktzone”. In der Kolonialzeit wie auch in der frühen postkolonialen Ära ermöglichte dieser Raum eine Vielzahl von Begegnungen: zwischen (Britisch) Indien, Tibet und China, aber auch Nepal und Bhutan; zwischen christlicher Mission und den Religionen des Himalaja; zwischen globalen Geld- und Informationsströmen und lokalen Märkten und Praktiken. Anhand einer Fülle lokaler und globaler historischer Quellen verfolgen die einzelnen Beiträge die Wege von Akteuren unterschiedlicher kultureller Hintergründe und untersuchen die neuen Formen von Wissen und Praktiken, die aus ihren Begegnungen und ihren wechselnden Machtbeziehungen hervorgingen. Der Band liefert daher nicht nur eine differenzierte Geschichtsschreibung zu Kalimpong und den angrenzenden Gebieten, sondern auch ein theoretisches Modell für die Untersuchung transkultureller Prozesse in Grenzräumen und deren kolonialer und postkolonialer Dynamiken.
Proust Cinématographe: Wie Raoul Ruiz Proust las
„Proust Cinématographe – wie Raoul Ruiz Proust las“ wirft über den Umweg der Literaturverfilmung einen ungewohnten Blick auf die metapoetischen Fundamente von Prousts Recherche: Über detaillierte Analysen ausgewählter Textpassus und Filmausschnitte gelingt hier der Nachweis, dass die grundlegende Problematik des Romans um die Wahrnehmung und Beschreibung von Zeit, Subjekt und Identität die Denkformen des modernen Kinos bereits im 19. Jahrhundert auf überraschend breiter Ebene antizipiert.
Die Untersuchung wird in einer intermedialen Präsentationsform geboten. Als Ergänzung des gedruckten Buches fungiert dabei die digitale Version, in der die audiovisuellen Zitate direkt aus dem Text heraus geöffnet werden können. So findet das intermedial analysierte Spiel um Wort und Bewegtbild sein Echo in der unmittelbaren Rezeptionsästhetik der Analyse.
Zum Abspielen der in einigen PDFs eingebetteten Videos empfehlen wir den Adobe Acrobat Reader DC.
Numerik 3: Probleme der Kontinuumsmechanik und ihre numerische Behandlung
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines mehrsemestrigen Zyklus ”Numerische Mathematik“, den der Autor über einen Zeitraum von 25 Jahren an der Universität Heidelberg gehalten hat. Der vorliegende vierte Teil ist Problemen der Kontinuumsmechanik, speziell der Struktur- und der Strömungsmechanik, und deren numerischer Lösung mit Finite-Elemente-Verfahren gewidmet. Dabei finden wieder sowohl theoretisch mathematische als auch praktische Aspekte Berücksichtigung. Als Grundlage einer sachgerechten numerischen Approximation werden die mathematischen Modelle systematisch aus physikalischen Grundpostulaten hergeleitet. Das Verständnis der Inhalte erfordert neben dem Stoff der vorausgehenden Bände ”Numerik 0 (Einführung in die Numerische Mathematik)“, ”Numerik 1 (Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen)“ und ”Numerik 2 (Numerik partieller Differentialgleichungen)“ nur solche Vorkenntnisse, wie sie üblicherweise in den Grundvorlesungen über Analysis und Lineare Algebra vermittelt werden.
Konstruktionen Europas in der Frühen Neuzeit: Geographische und historische Imaginationen. Beiträge zur 11. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit
Globalgeschichtliche Zugriffe sind in der Geschichtswissenschaft angekommen. Auf der 11. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit hatten sich die Beiträger zum Ziel gesetzt, Europa im Kontext ferner Weltregionen in den Blick zu nehmen. „Europa“ unterlag als politisch-kulturelle Raumvorstellung und auch als Forschungsgegenstand immer wieder vielschichtigen Aushandlungsprozessen, die nicht nur entlang territorialer Herrschaftsgrenzen, eindeutiger Topographien oder von Sprachräumen verliefen. Die Ergebnisse der Tagung eröffnen neue Blicke auf geographisch und historisch imaginierte Selbst- und Fremdzuschreibungen, Behauptungen von Identität und Alterität und die Wandelbarkeit von Peripherie und Zentrum. Sie bilden zugleich eine Werkschau aktueller Forschungsfelder der international weit vernetzten historischen Frühneuzeitforschung in Deutschland.
Wilhelm Windelband und die Psychologie: Das Fach Philosophie und die Wissenschaft Psychologie im Deutschen Kaiserreich
Wilhelm Windelband (1848-1915) war Ordinarius der Philosophie im Deutschen Kaiserreich, Haupt der südwestdeutschen Schule des Neukantianismus und einflussreicher Kathederfürst. Dem Neukantianismus wird Gegnerschaft zur Psychologie nachgesagt, und Windelband gilt in der Wissenschaftsgeschichte als jemand, der eine ausgeprägte Abneigung gegen die Psychologie hegte und diese polemisch von sich gab. Die hier erstmalig untersuchte Wirklichkeit sah anders aus. Er setzte sich frühzeitig für die Selbständigkeit der Psychologie ein, arbeitete an einem Buch zur Psychologie und hielt mehr als zwanzig Hauptvorlesungen zur Psychologie. Institutionelle Hintergründe des problematischen Verhältnisses zwischen Philosophie und Psychologie werden untersucht und gezeigt, weshalb Windelband kein Einzelfall in der Geschichte des Faches Philosophie war.
Numerik 2: Numerik partieller Differentialgleichungen
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines mehrsemestrigen Zyklus ”Numerische Mathematik“, den der Autor über einen Zeitraum von 25 Jahren an der Universität Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden dritten Teil werden numerische Verfahren zur approximativen Lösung partieller Differentialgleichungen behandelt. Dabei finden wieder sowohl theoretisch-mathematische als auch praktische Aspekte Berücksichtigung.
Das Verständnis der Inhalte erfordert neben dem Stoff der ersten beiden Bände „Numerik 0 (Einführung in die Numerische Mathematik)“ und „Numerik 1 (Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen)“ nur solche Vorkenntnisse, wie sie üblicherweise in den Grundvorlesungen über Analysis und Lineare Algebra vermittelt werden. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen wieder theoretische und praktische Übungsaufgaben mit Lösungen.
The Transformative Power of the Copy: A Transcultural and Interdisciplinary Approach
Der Band eröffnet eine neue Perspektive auf das Phänomen der “Kopie” und die Praxis des Kopierens. Wenngleich sich die Forschung der letzten Jahrzehnte intensiv mit den Themen Kopie und Kopieren beschäftigt hat, geschah dies kaum im Kontext der Diskussionen zur Transkulturalität. Die Autor_innen dieses Bandes, welche ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen repräsentieren, gehen dieses Desiderat an, indem sie das Thema aus einer transkulturellen Perspektive betrachten. Ihr Ziel ist es nicht, zu einer einheitlichen Definition von Kopie zu gelangen, sondern die ihr inhärente Dynamik und transformative Kraft zu erforschen. Kopie und Praxis des Kopierens werden als Bestandteile von Transkulturalität verstanden. Die Beiträge, deren zeitlicher Rahmen von der Antike bis in die Gegenwart reicht und die räumlich in Europa und Asien lokalisiert sind, sollen vor allem zum Denken anregen. Der Band will dazu beitragen,einen neuen, interdisziplinären Diskurs über die Kopie und deren transkulturellen Einfluss anzuregen.
Numerik 1: Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines mehrsemestrigen Zyklus "Numerische Mathematik“, den der Autor über einen Zeitraum von 25 Jahren an der Universität Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden zweiten Teil werden numerische Verfahren zur approximativen Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen behandelt. Dabei finden wieder sowohl theoretisch-mathematische als auch praktische Aspekte Berücksichtigung. Im letzten Kapitel wird noch ein kurzer Ausblick auf die numerische Behandlung partieller Differentialgleichungen gegeben. Das Verständnis der Inhalte erfordert neben dem Stoff des ersten Bandes ”Numerik 0 (Einführung in die Numerische Mathematik)“ nur solche Vorkenntnisse, wie sie üblicherweise in den Grundvorlesungen über Analysis und Lineare Algebra vermittelt werden. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen wieder theoretische und praktische Übungsaufgaben mit Lösungen.
Numerik 0: Einführung in die Numerische Mathematik
Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines mehrsemestrigen Zyklus „Numerische Mathematik“, den der Autor über einen Zeitraum von 25 Jahren an der Universität Heidelberg gehalten hat. Im vorliegenden ersten Teil werden die fundamentalen Konzepte numerischer Verfahren für Grundaufgaben aus Analysis und Lineare Algebra behandelt. Dabei finden sowohl theoretisch-mathematische als auch praktische Aspekte Berücksichtigung. Das Verständnis der Inhalte erfordert nur solche Vorkenntnisse, wie sie üblicherweise in den Grundvorlesungen über Analysis und Lineare Algebra vermittelt werden. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen theoretische und praktische Übungsaufgaben mit Lösungen.
Wir haben ja alle Deutschland nicht gekannt: Das Deutschlandbild der Deutschen in der Zeit der Weimarer Republik
Nach 1918 musste sich Deutschland politisch und sozial neu definieren, aber sich auch als Land, als geographische und kulturelle Einheit neu entdecken. Es setzte ein Prozess ein, den man mit einem Begriff der Zeit als „Innere Kolonisation“ bezeichnen kann. Zur Kompensation der vielen Verluste machten sich Wissenschaftler und Künstler daran, jene Dimension, die in Frankreich „la France profonde“ heißt, zu erschließen, das „innere“ Deutschland also, seine einzigartige Kulturdichte. Die Ökonomie des Sparenmüssens wurde zur Überflusswirtschaft der geistigen und materiellen Reichtümer konvertiert. Die dabei entdeckte neue deutsche Tugend der Vielfalt ließ sich in Phrasen und Parolen kurz antönen – dieses Buch aber widmet sich all den Texten und Bildern, die aus einer „Arbeit im Material“ (Siegfried Kracauer) entstanden sind, aus neuer, authentischer Erfahrung und „Nähe der Anschauung“ (Ernst Glaeser) gewonnen wurden.
Die limitierte Auflage: Rechtsfragen zeitgenössischer Fotokunst
Die Fotografie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der populärsten Kunstgattungen entwickelt. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch am Erfolg der zeitgenössischen Fotografie auf dem Kunstmarkt, wo einzelne Abzüge mittlerweile für Millionenbeträge gehandelt werden. Diese hohe finanzielle Wertschätzung einzelner Fotografien wäre undenkbar, würde das Potenzial der Fotografie zur nahezu unendlichen Reproduktion tatsächlich ausgeschöpft. Im Gegenteil hat sich im Bereich der zeitgenössischen Fotokunst die Praxis etabliert, Fotografien nur in sogenannten „limitierten Auflagen“ aufzulegen, bei denen teilweise sogar mit einstelligen Auflagenhöhen gearbeitet wird. Die vorliegende Dissertation untersucht die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit solchen Auflagenlimitierungen und geht dabei insbesondere der Frage nach, ob solche „Exklusivitätsversprechen“ rechtlich bindend sind und somit beispielsweise von einem Sammler eingeklagt werden könnten.
Die Dissertation wurde 2016 mit dem Dissertationspreis des Instituts für Kunst und Recht IFKUR e.V. ausgezeichnet.
Il libro de la cocina: Un ricettario tra Oriente e Occidente
Wie die gesamte europäische Küche ist auch der senesische Libro de la cocina historisch gewachsen. Seine Ursprünge sind teils in Italien, teils in anderen Kulturen zu suchen: Er vereint Rezepte aus der toskanischen Küche mit solchen, die direkt aus dem älteren lateinischen Liber de coquina stammen, einem Kochbuch aus Neapel, das die Schnittstelle zwischen orientalischer und westeuropäischer Kochliteratur darstellt.
Der in diesem Buch edierte Libro de la cocina aus dem 2. Drittel des 14. Jahrhunderts offenbart die ganze Palette altitalienischer Kochkunst: einfache und komplizierte Gemüse-, Fleisch- und Fischspeisen, Süßspeisen und diätetische Rezepturen. Viele der knapp 200 Rezepte sind mit orientalischen, französischen, englischen und italienischen Vorgängern und Nachfolgern verknüpft. Ein vollständiges kritisches Glossar erschließt die Texte; volkssprachliche und lateinische Paralleltexte sind mit abgedruckt.
Passing Through Shanghai: Ethnographic Insights into the Mobile Lives of Expatriate Youths
Passing Through Shanghai untersucht das Erleben internationaler Mobilität aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. Im Fokus des Buches stehen Kinder von Firmenentsandten – sogenannten Expats – die einen Teil ihrer Jugend im gegenwärtigen Shanghai verbringen: Eine an sich heterogene Gruppe, deren Lebensstil jedoch aufgrund der internationalen Karrieren der Eltern bestimmte gemeinsame Privilegien, aber auch Herausforderungen aufweist.
Das Buch geht der Frage nach, wie Kinder und Jugendliche kulturelle Identität unter den Bedingungen hoher Mobilität empfinden und aushandeln. Gestützt auf die Ergebnisse ethnographischer Feldforschung aus den Jahren 2010 bis 2012 nimmt Passing Through Shanghai den Alltag der Expat-Teenager an internationalen Schulen, ihr Erleben und Nutzen der Stadt, ihre Träume und Hoffnungen sowie ihre Fragen nach Zugehörigkeit und Heimat in den Blick. Der ethnographische Ansatz erfasst den permanenten Schwebezustand des häufigen Umziehens, der diese Jugendlichen beim Aufwachsen begleitet, und erforscht ihre persönlichen Sichtweisen auf den "Transitraum" Shanghai. Die Perspektiven der Teenager und ihre Erfahrungen in einer Gemeinschaft aus Expats bieten Einblicke in die Zusammenhänge und Widersprüche zwischen der erstrebten Flexibilität von Identitäten im 21. Jahrhundert und der gleichzeitigen Starrheit kultureller Grenzen, die auf Nationalität, Ethnizität, Geschlecht und sozialer Herkunft basieren.
Abwesenheit von Rom: Aristokratische Interaktion in der späten römischen Republik und in der frühen Kaiserzeit
Der immensen ideellen Bedeutung, die der Stadt Rom seit der späten Republik zugemessen wurde, entsprach bis in das 2. Jhd. n. Chr. die reale Vorrangstellung der urbs im Imperium Romanum: In Rom trafen die gesellschaftlich und politisch maßgebenden Akteure und Gruppen aufeinander, hier versuchten sie in Form komplexer Interaktionen gegenseitiges Verständnis und Einvernehmen herzustellen. Bis in die Kaiserzeit betrachtete die Senatsaristokratie die interagierende Präsenz in Rom als wesentliche Größe ihrer Lebensführung. Zumindest im 1. Jhd. n. Chr. konnten sich auch die Kaiser nicht vom Referenzrahmen der Stadt lösen. Umso interessanter sind Formen und Anlässe aristokratischer oder kaiserlicher Absenz. Welche Funktionen die Abwesenheit von Rom im System der aristokratischen Interaktion hatte und welche Implikationen dies für Politik und Gesellschaft der späten Republik und frühen Kaiserzeit mit sich brachte, ist Gegenstand der vorliegenden Studie.
Die Arbeit wurde 2012 mit dem Preis des Historischen Instituts der Universität Bern für die beste Dissertation des Jahres 2012 ausgezeichnet.