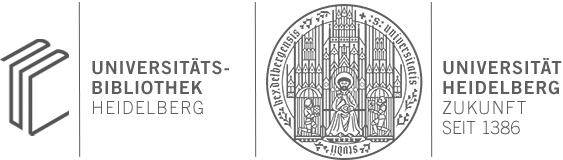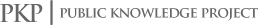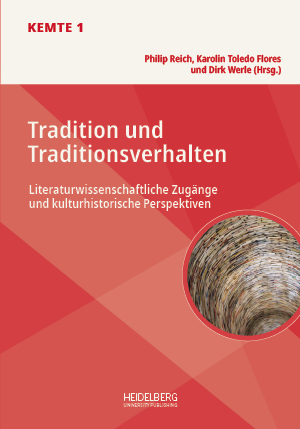
Zitationsvorschlag
Lizenz

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Identifier
Veröffentlicht
Tradition und Traditionsverhalten
Literaturwissenschaftliche Zugänge und kulturhistorische Perspektiven
‚Tradition‘ zählt zu den zentralen Reflexionskategorien der abendländischen Kulturgeschichte, wenn es darum geht, Rezeptionsprozesse und deren Wirkmächtigkeit zu beschreiben. Gerade auch in der Literaturwissenschaft wird häufig von Traditionen gesprochen, etwa davon, dass ein Text ‚in der Tradition‘ eines anderen Texts stehe. Dennoch bleibt dabei das Konzept theoretisch oft unterbestimmt. Der vorliegende Band nähert sich mit theoretischen Grundlagenreflexionen und exemplarischen literatur- und kulturhistorischen Fallstudien aus verschiedenen literarischen Konstellationen und Epochen der generellen Frage „Was ist Tradition?“ und der spezifischeren Frage „Wie kann man adäquat über literarische Traditionen sprechen?“ an.